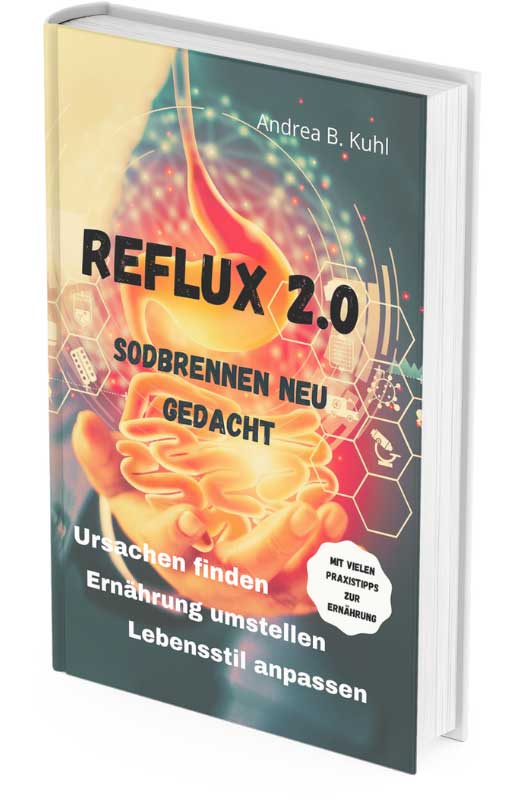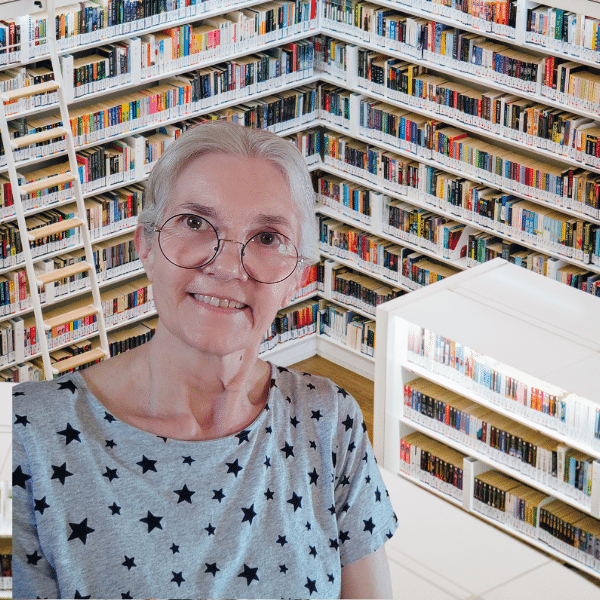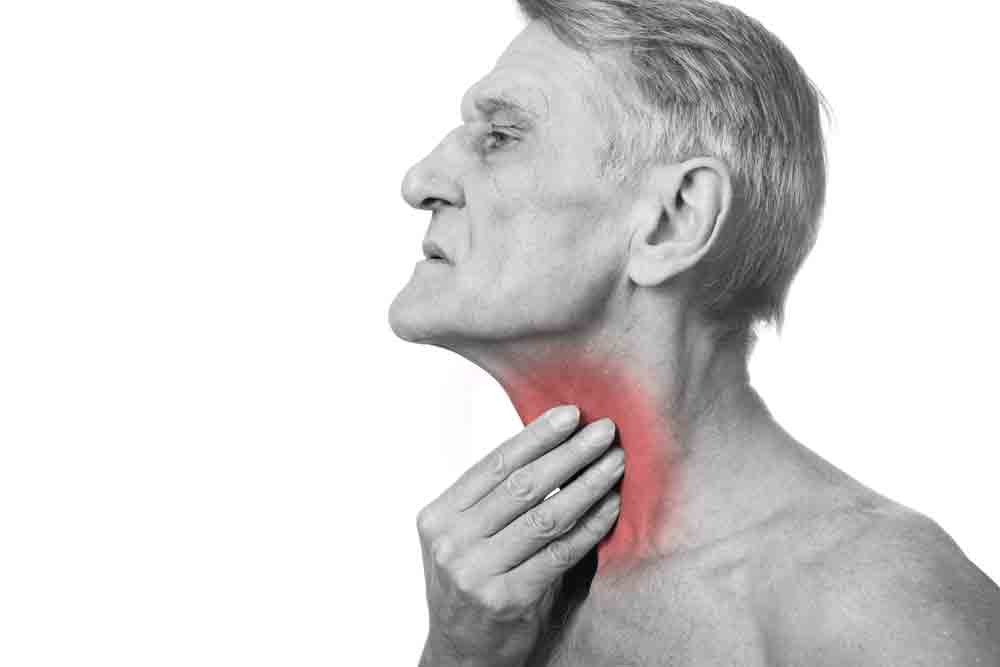
Einleitung
überarbeitet: 05.05.2025
Wenn du dich beim Essen häufig verschluckst, unter Sodbrennen leidest oder das Gefühl hast, dass Speisen in deiner Brust stecken bleiben, könnte ein Speiseröhrendivertikel die Ursache sein. Dieses oft übersehene Phänomen betrifft etwa 0,5 bis 2 Prozent der Bevölkerung, wird jedoch aufgrund seiner unspezifischen Symptome häufig fehldiagnostiziert oder spät erkannt (Altorjay et al., 2017).
Ein Divertikel ist eine sackartige Ausstülpung der Speiseröhrenwand. Stell dir vor, du drückst mit dem Finger auf einen aufgeblasenen Luftballon – die entstehende Ausbuchtung entspricht in etwa einem Divertikel. In der Speiseröhre können diese Ausbuchtungen an verschiedenen Stellen auftreten und unterschiedliche Beschwerden verursachen.
In diesem umfassenden Artikel erfährst du alles Wichtige über Speiseröhrendivertikel: von den anatomischen Grundlagen über Ursachen und Symptome bis hin zu modernen Diagnose- und Behandlungsmethoden. Zudem erhältst du praktische Tipps für den Alltag und einen Einblick in die aktuelle Forschung.
Was sind Speiseröhrendivertikel?
Speiseröhrendivertikel sind also sackartige Ausstülpungen der Speiseröhrenwand. Je nachdem, welche Wandschichten beteiligt sind, unterscheidet man:
- Echte Divertikel: Alle Wandschichten sind ausgestülpt
- Falsche Divertikel (Pseudodivertikel): Nur die Schleimhaut und die Submukosa stülpen sich durch Lücken in der Muskelschicht
Nach ihrer Lokalisation werden Speiseröhrendivertikel in drei Haupttypen eingeteilt:
1. Zenker-Divertikel (Hypopharyngeales Divertikel)
Das Zenker-Divertikel ist mit etwa 70% aller Speiseröhrendivertikel der häufigste Typ. Es entsteht im Bereich des oberen Ösophagussphinkters an der Rückwand des Rachens, genauer gesagt in einer natürlichen Schwachstelle zwischen zwei Muskeln (dem M. cricopharyngeus und dem M. constrictor pharyngis inferior). Diese Region wird auch als Killian-Dreieck bezeichnet.
Zenker-Divertikel treten hauptsächlich bei Menschen über 60 Jahren auf und sind bei Männern doppelt so häufig wie bei Frauen. Sie entstehen durch einen erhöhten Druck beim Schlucken, wenn sich der obere Schließmuskel nicht richtig entspannt (Zawadzki & Starck, 2018).
2. Mittlere Ösophagusdivertikel (Traktionsdivertikel)
Diese Form macht etwa 15-20% der Fälle aus und tritt im mittleren Drittel der Speiseröhre auf, meist auf Höhe der Luftröhrenverzweigung (Carina). Im Gegensatz zum Zenker-Divertikel entstehen mittlere Divertikel nicht durch Druckerhöhung im Inneren der Speiseröhre, sondern durch Zug von außen, oft durch vernarbte Lymphknoten nach entzündlichen Erkrankungen wie Tuberkulose.
3. Epiphrenische Divertikel
Diese seltenere Form (etwa 10-15% der Fälle) befindet sich im unteren Drittel der Speiseröhre, kurz vor dem Zwerchfell. Epiphrenische Divertikel sind häufig mit Motilitätsstörungen wie Achalasie oder diffusem Ösophagusspasmus assoziiert.
Ursachen und Risikofaktoren
Die Entstehung von Speiseröhrendivertikeln ist multifaktoriell und variiert je nach Typ. Hier sind die wichtigsten Ursachen und Risikofaktoren:
Für Zenker-Divertikel:
- Funktionsstörungen des oberen Ösophagussphinkters: Eine unzureichende Entspannung des Schließmuskels während des Schluckens führt zu erhöhtem Druck und damit zur Bildung des Divertikels
- Altersbedingte Veränderungen: Abnahme der Elastizität des Bindegewebes und Muskelschwäche
- Chronische Entzündungen im Pharynx-Bereich (Kehlkopf-Bereich)
- Genetische Prädisposition: Familiäre Häufungen wurden beobachtet
Für mittlere Divertikel:
- Entzündliche Prozesse im umliegenden Gewebe (historisch oft Tuberkulose)
- Vernarbte Lymphknoten nach Infektionen
- Traumatische Verletzungen des Mediastinums
Für epiphrenische Divertikel:
- Motilitätsstörungen der Speiseröhre wie Achalasie oder diffuser Ösophagusspasmus
- Gastroösophagealer Reflux mit chronischer Entzündung
- Erhöhter intraluminaler Druck durch Schluckstörungen
Allgemeine Risikofaktoren, die die Entstehung begünstigen können:
- Höheres Lebensalter (besonders > 60 Jahre)
- Männliches Geschlecht (v.a. beim Zenker-Divertikel)
- Chronischer Alkoholkonsum und Rauchen
- Bindegewebserkrankungen wie Sklerodermie
- Chronische Obstipation mit häufigem Pressen
Klinische Symptome
Die Symptome von Speiseröhrendivertikeln entwickeln sich typischerweise langsam über Monate oder Jahre und können je nach Lokalisation, Größe und Form des Divertikels stark variieren. Viele kleine Divertikel verursachen zunächst keine oder nur geringfügige Beschwerden.
Typische Symptome bei Zenker-Divertikel:
- Dysphagie (Schluckbeschwerden), besonders bei fester Nahrung
- Regurgitation (Hochkommen unverdauter Nahrung) Stunden nach dem Essen, besonders im Liegen
- Gurgelnde Geräusche beim Schlucken
- Foetor ex ore (übler Mundgeruch) durch Nahrungsreste im Divertikel
- Nächtlicher Husten durch Aspiration von Divertikelinhalt Einatmen von Divertikelinhalt
- Halsschmerzen und Fremdkörpergefühl
- Gewichtsverlust bei ausgeprägten Schluckstörungen
Ein charakteristisches Zeichen ist das sogenannte "Gurgling" – ein gurgelndes Geräusch, das entsteht, wenn Luft durch flüssigkeitsgefüllte Divertikel strömt.
Symptome bei mittleren und epiphrenischen Divertikeln:
- Retrosternale Schmerzen (Schmerzen hinter dem Brustbein)
- Sodbrennen und saures Aufstoßen
- Druckgefühl in der Brust nach dem Essen
- Dysphagie (weniger ausgeprägt als bei Zenker-Divertikeln)
- Rezidivierende Aspirationspneumonien bei großen Divertikeln: Wiederkehrende Lungenentzündungen durch Einatmen von Divertikelinhalt
Eine besondere Gefahr stellen Komplikationen wie:
- Aspirationspneumonie durch nächtliches Eindringen von Divertikelinhalt in die Lunge
- Divertikulitis (Entzündung des Divertikels)
- Blutungen aus dem Divertikel
- Perforation (Durchbruch) mit Mediastinitis Durchbruch des Divertikels in das umliegende Bindegewebe
- Maligne Entartung (selten, ca. 0,5% der Fälle)
Diagnostik
Wenn du die oben genannten Symptome bei dir bemerkst, solltest du einen Arzt aufsuchen. Die Diagnostik von Speiseröhrendivertikeln umfasst mehrere Untersuchungen:
Anamnese und körperliche Untersuchung
Der erste Schritt ist ein ausführliches Gespräch mit deinem Arzt, in dem er nach deinen Beschwerden, deren Dauer und Intensität fragt. Bei Verdacht auf ein Zenker-Divertikel kann der Arzt manchmal durch Palpation (Abtasten) des Halses eine weiche Schwellung feststellen oder beim Drücken auf den Hals ein Gurgelgeräusch auslösen.
Bildgebende Verfahren
Ösophagografie (Breischluck-Untersuchung)
Dies ist die wichtigste Untersuchung zum Nachweis von Speiseröhrendivertikeln. Dabei schluckst du ein Kontrastmittel (meist Bariumsulfat), während unter Durchleuchtung Röntgenaufnahmen in verschiedenen Projektionen erstellt werden. Diese Methode zeigt:
- Die genaue Lokalisation des Divertikels
- Seine Größe und Form
- Die Verbindung zur Speiseröhre
- Funktionelle Störungen beim Schlucken
Computertomografie (CT)
Ein CT des Halses und Thorax kann helfen, die räumliche Beziehung des Divertikels zu Nachbarstrukturen darzustellen und mögliche Komplikationen wie Entzündungen oder Abszesse zu erkennen.
Endoskopische Verfahren
Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD)
Bei der Spiegelung der Speiseröhre ist besondere Vorsicht geboten, da das Risiko besteht, mit dem Endoskop in das Divertikel einzudringen und es zu perforieren. Daher wird die Endoskopie oft unter radiologischer Kontrolle durchgeführt. Sie ermöglicht:
- Die direkte Visualisierung des Divertikels
- Die Entnahme von Gewebeproben bei Verdacht auf Entzündung oder Entartung
- Die Beurteilung der Schleimhaut
Es ist wichtig zu wissen, dass bei Verdacht auf ein Zenker-Divertikel die Endoskopie mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden muss oder sogar kontraindiziert sein kann.
Hochauflösende Ösophagusmanometrie
Diese Untersuchung misst den Druck in verschiedenen Abschnitten der Speiseröhre und kann funktionelle Störungen wie Achalasie oder Ösophagusspasmus nachweisen, die oft mit Divertikeln assoziiert sind. Sie ist besonders wichtig bei epiphrenischen Divertikeln, da hier fast immer Motilitätsstörungen als Ursache vorliegen (Herbella & Patti, 2012).
24-Stunden-pH-Metrie und Impedanzmessung
Bei Verdacht auf gastroösophagealen Reflux als begünstigenden Faktor kann eine Langzeit-pH-Wert-Messung in der Speiseröhre durchgeführt werden.
Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlung von Speiseröhrendivertikeln richtet sich nach der Art des Divertikels, der Schwere der Symptome und dem Allgemeinzustand des Patienten. Grundsätzlich gibt es drei Therapieansätze:
1. Konservative Therapie
Bei kleinen, asymptomatischen Divertikeln oder bei Patienten mit hohem Operationsrisiko kann zunächst eine abwartende Haltung mit regelmäßigen Kontrollen sinnvoll sein. Folgende Maßnahmen können die Beschwerden lindern:
- Diätetische Maßnahmen: Weiche, breiige Kost; langsames Essen in aufrechter Position; kleinere, häufigere Mahlzeiten
- Kopferhöhung nachts um 30-45° zur Vermeidung von Regurgitation und Aspiration
- Vermeidung von Alkohol und Nikotin
- Protonenpumpenhemmer bei begleitendem Reflux
- Logopädische Therapie zur Optimierung des Schluckvorgangs
2. Endoskopische Therapie
Besonders für Zenker-Divertikel hat sich die endoskopische Therapie als Standardverfahren etabliert (Mulder et al., 2020). Die flexible oder starre endoskopische Divertikulotomie umfasst:
- Spaltung der Muskelbrücke (Septum) zwischen Divertikel und Speiseröhre
- Dadurch Schaffung einer gemeinsamen Höhle und Beseitigung der Druckkammer
- Durchführung mittels Laser, Stapler oder Argon-Plasma-Koagulation
Vorteile der endoskopischen Therapie:
- Geringere Invasivität
- Kürzere Krankenhausaufenthaltsdauer
- Schnellere Nahrungsaufnahme nach dem Eingriff
- Geeignet auch für ältere, multimorbide Patienten
3. Chirurgische Therapie
Bei großen Divertikeln, Versagen der endoskopischen Therapie oder bei mittleren und epiphrenischen Divertikeln kann eine operative Behandlung notwendig sein:
Für Zenker-Divertikel:
- Divertikelresektion: Entfernung des Divertikelsacks
- Divertikelopexy: Fixierung des Divertikels
- Myotomie des M. cricopharyngeus: Durchtrennung des Muskels zur Druckentlastung
Für mittlere und epiphrenische Divertikel:
- Divertikelresektion mit oder ohne Myotomie
- Laparoskopische oder thorakoskopische minimal-invasive Verfahren
- Bei epiphrenischen Divertikeln zusätzlich oft Heller-Myotomie und Fundoplikatio zur Behandlung der zugrundeliegenden Motilitätsstörung
Die Erfolgsraten der operativen Verfahren liegen bei 80-95%, wobei die Rezidivrate bei 5-15% liegt (Achim et al., 2017).
Postoperativer Verlauf und Komplikationen
Nach endoskopischen oder chirurgischen Eingriffen ist mit folgenden Heilungsverläufen zu rechnen:
- Nahrungsaufnahme: Nach endoskopischen Eingriffen oft schon am ersten postoperativen Tag; nach chirurgischen Eingriffen erst nach 3-7 Tagen nach Ausschluss einer Nahtinsuffizienz mittels Kontrastmittelschluck
- Krankenhausaufenthalt: 1-2 Tage nach endoskopischer, 7-10 Tage nach offener chirurgischer Therapie
- Rückkehr zu normalen Aktivitäten: Innerhalb von 1-3 Wochen
Mögliche Komplikationen:
- Mediastinitis durch Nahtinsuffizienz (1-3%)
- Blutungen
- Rekurrensparese (Stimmbandlähmung)
- Postoperative Dysphagie
- Rezidiv des Divertikels
- Narbenstrikturen
Leben mit Speiseröhrendivertikeln: Praktische Tipps für den Alltag
Wenn bei dir ein Speiseröhrendivertikel diagnostiziert wurde oder du dich nach einer Behandlung in der Rehabilitationsphase befindest, können folgende Tipps hilfreich sein:
Ernährungsempfehlungen:
- Konsistenz der Nahrung an deine individuellen Schluckfähigkeiten anpassen
- Kleine, häufige Mahlzeiten statt wenige große
- Langsames Essen mit gründlichem Kauen
- Aufrechte Körperhaltung beim Essen und mindestens 30 Minuten danach
- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu den Mahlzeiten
- Vermeidung von Alkohol und kohlensäurehaltigen Getränken, die Reflux verstärken können
Schlafhygiene:
- Erhöhte Kopfposition (15-20 cm) durch spezielles Keilkissen oder erhöhtes Kopfteil
- Letzte Mahlzeit mindestens 3 Stunden vor dem Schlafengehen
- Rechtsseitenlage vermeiden, da sie Reflux begünstigt
Mundpflege:
- Regelmäßige, gründliche Zahnpflege zur Vermeidung von Karies und Mundgeruch durch Nahrungsreste im Divertikel
- Mundspülungen nach den Mahlzeiten
- Bei Zenker-Divertikel: Erlernen spezieller Manöver zum Entleeren des Divertikels
Regelmäßige ärztliche Kontrollen:
- Follow-up-Untersuchungen nach Therapie
- Kontrastmittelschluck-Kontrollen in regelmäßigen Abständen
- Bei neu auftretenden Symptomen frühzeitig ärztlichen Rat einholen
Forschung und neue Entwicklungen
Die Forschung zu Speiseröhrendivertikeln konzentriert sich auf mehrere Bereiche:
Pathophysiologisches Verständnis:
Neuere Studien untersuchen die genauen molekularen und zellulären Mechanismen, die zur Entstehung von Divertikeln führen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle von Entzündungsprozessen und der extrazellulären Matrix bei der Schwächung der Ösophaguswand (Koch et al., 2019).
Verbesserte diagnostische Verfahren:
Die Entwicklung hochauflösender endoskopischer Verfahren wie der konfokalen Laserendomikroskopie ermöglicht eine detailliertere Beurteilung der Schleimhaut im Divertikel und könnte zur früheren Erkennung von Entzündungen oder malignen Veränderungen beitragen.
Neue Behandlungsansätze:
- Submuköse Endoskopietechniken wie POEM (Peroral Endoscopic Myotomy) werden zunehmend auch bei Divertikeln eingesetzt
- Entwicklung biologisch abbaubarer Stents zur temporären Stabilisierung nach endoskopischer Therapie
- Stammzelltherapie zur Regeneration geschädigter Muskelgewebe befindet sich in frühen Forschungsstadien
- Roboter-assistierte minimal-invasive Chirurgie für komplexe Fälle
Klinische Studien:
Aktuelle klinische Studien vergleichen verschiedene endoskopische Techniken hinsichtlich ihrer Langzeitergebnisse und Komplikationsraten. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die flexible endoskopische Septotomie bei Zenker-Divertikeln vergleichbare Erfolgsraten wie die starre Endoskopie bei geringerer Komplikationsrate aufweist (Yang et al., 2020).
Fazit
Speiseröhrendivertikel sind zwar selten, können aber erhebliche Beschwerden verursachen und die Lebensqualität beeinträchtigen. Durch das bessere Verständnis ihrer Entstehung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten haben sich die Behandlungsergebnisse in den letzten Jahren deutlich verbessert.
Wenn du an schluckbezogenen Symptomen leidest, die über einen längeren Zeitraum anhalten, solltest du nicht zögern, einen Arzt aufzusuchen. Je früher ein Divertikel erkannt wird, desto einfacher ist in der Regel die Behandlung. Besonders wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Gastroenterologen, HNO-Ärzten, Thoraxchirurgen und Radiologen für eine optimale Versorgung.
Die Prognose bei adäquater Behandlung ist gut – über 90% der Patienten berichten über eine deutliche Verbesserung oder vollständige Beseitigung ihrer Beschwerden nach der Therapie.
Quellen
- Achim, V., Kashima, M., & Sarna, A. (2017). Revised surgical techniques for the treatment of Zenker's diverticulum. Otolaryngology Clinics of North America, 50(5), 959-971.
- Altorjay, A., Botos, B., & Palásti, Z. (2017). Esophageal diverticula: Pathophysiology, classification and therapy. Orv Hetil, 158(21), 803-811.
- Herbella, F. A., & Patti, M. G. (2012). Modern pathophysiology and treatment of esophageal diverticula. Langenbeck's Archives of Surgery, 397(1), 29-35.
- Koch, O. O., Kaindlstorfer, A., Antoniou, S. A., Asche, K. U., Granderath, F. A., & Pointner, R. (2019). Comparison of results from different surgical techniques for treatment of Zenker's diverticulum. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, 11(2), 115-123.
- Mulder, C. J., Costamagna, G., & Sakai, P. (2020). Zenker's diverticulum: can flexibility tip the balance? Endoscopy, 52(6), 467-468.
- Sakai, P., Ishioka, S., & Maluf-Filho, F. (2019). Endoscopic treatment of Zenker's diverticulum with flexible endoscope: review of literature. Gastroenterology Endoscopy, 90(1), 31-37.
- Zawadzki, M., & Starck, R. (2018). Modern treatment of Zenker diverticulum: The need for a tailored approach. World Journal of Surgery, 42(7), 1929-1935.
- Yang, J., Zhu, H., & Wu, D. (2020). Comparison of endoscopic and surgical approaches for treating Zenker's diverticulum: A systematic review and meta-analysis. Gastrointestinal Endoscopy, 91(5), 1040-1052.e5.
- Bartolome, G. und Schröter-Morasch, H.: Schluckstörungen: Interdisziplinäre Diagnostik und Rehabilitation, Elsevier, 6. Auflage 2018.
- Schumpelick, V.: Praxis der Viszeralchirurgie: Gastroenterologische Chirurgie, Springer, 3. Auflage 2011.
- Koop, I.: Gastroenterologie compact: Alles für Klinik und Praxis, Thieme, 3. Auflage 2013.
- Messmann, H.: Klinische Gastroenterologie: Das Buch für Fort- und Weiterbildung plus DVD mit über 1.000 Befunden, Thieme, 2011.
- Prosiegel, M. und Weber, S.: Dysphagie: Diagnostik und Therapie. Ein Wegweiser für kompetentes Handeln, Springer, 3. Auflage 2018.
- Bechtler, M. und Jakobs, R.: Ösophagusdivertikel. In: Gastroenterologie up2date 3,8 (2012), S. 187–196. DOI: 10.1055/s-00000133.
Das Buch zu Reflux

Sodbrennen ist nachhaltig therapierbar
Du hast schon Jahre hindurch Reflux und andere Magenprobleme, doch die Ärzte finden nichts?
Alle sagen, einmal Reflux immer Reflux?
Das kannst Du glauben, wenn du willst.
Oder Du hast den Mut, dich selber aus der Refluxfalle zu befreien!
Ich zeige Dir wie!